Inhaltsverzeichnis
Das Gedicht José von Carlos Drummond de Andrade wurde ursprünglich 1942 in der Sammlung Gedichte .
Sie veranschaulicht das Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit des Einzelnen in der Großstadt, seine Hoffnungslosigkeit und das Gefühl, im Leben verloren zu sein und nicht zu wissen, welchen Weg er gehen soll.
José
Was nun, José?
Die Party ist vorbei,
ging das Licht aus,
die Menschen sind verschwunden,
wurde die Nacht kalt,
Und jetzt, José?
und jetzt Sie?
Siehe auch: Bráulio Bessa und seine 7 besten Gedichteihr, die ihr namenlos seid,
der sich über andere lustig macht,
ihr, die ihr Verse macht,
wer liebt, protestiert?
Und jetzt, José?
Er ist ohne Frau,
ist ohne Sprache,
ist ohne Zuneigung,
nicht mehr trinken kann,
darf nicht mehr rauchen,
Spucken ist nicht mehr erlaubt,
wurde die Nacht kalt,
der Tag ist nicht gekommen,
Die Straßenbahn ist nicht gekommen,
Das Lachen blieb aus,
die Utopie ist nicht gekommen
und es ist alles vorbei
und alles lief davon
und alles ist verschimmelt,
Und jetzt, José?
Was nun, José?
Sein süßes Wort,
seinen Fieberanfall,
ihre Völlerei und ihr Fasten,
Ihre Bibliothek,
seine Goldmine,
seinen gläsernen Anzug,
seine Inkohärenz,
Ihr Hass - was nun?
Mit dem Schlüssel in der Hand
will die Tür öffnen,
es gibt keine Tür;
will auf See sterben,
aber das Meer trocknete aus;
will nach Minas gehen,
Es gibt keine Minen mehr.
José, was nun?
Wenn du rufst,
wenn du stöhnst,
wenn Sie gespielt haben
den Wiener Walzer,
wenn du geschlafen hast,
wenn Sie müde werden,
Siehe auch: O Meu Pé de Laranja Lima (Zusammenfassung und Analyse des Buches)wenn du sterben würdest
Aber man stirbt nicht,
Du bist hart im Nehmen, José!
Allein in der Dunkelheit
Was für ein Murmeltier,
ohne Theogonie,
keine kahle Wand
zum Anlehnen,
kein schwarzes Pferd
der im Galopp davonläuft,
Du marschierst, José!
José, wohin?
Analyse und Interpretation des Gedichts
In der Komposition zeigt der Dichter seinen modernistischen Charakter, mit Elementen wie dem freien Vers, dem Fehlen eines metrischen Musters in den Versen und der Verwendung von volkstümlicher Sprache und Alltagsszenarien.
Erste Strophe
Was nun, José?
Die Party ist vorbei,
ging das Licht aus,
die Menschen sind verschwunden,
wurde die Nacht kalt,
Und jetzt, José?
und jetzt Sie?
ihr, die ihr namenlos seid,
der sich über andere lustig macht,
ihr, die ihr Verse macht,
wer liebt, protestiert?
Und jetzt, José?
Er beginnt mit einer Frage, die sich im Laufe des Gedichts wiederholt, zu einer Art Refrain wird und immer mehr an Kraft gewinnt: "Was nun, José?" Jetzt, wo die guten Zeiten vorbei sind, wo "die Party vorbei ist", "das Licht aus ist", "die Leute weg sind", was bleibt da noch? Was ist zu tun?
Diese Frage ist das Thema und der Motor des Gedichts, die Suche nach einem Weg, einem möglichen Sinn. José, ein in Brasilien sehr verbreiteter Name, kann als kollektives Subjekt verstanden werden, als Symbol eines Volkes.
Wenn der Autor die Frage wiederholt und dann "Joseph" durch "Sie" ersetzt, können wir davon ausgehen, dass er sich an den Leser wendet, so als wären wir alle auch der Gesprächspartner.
Er ist ein banaler Mann, "der namenlos ist", aber "Verse macht", "liebt, protestiert", in seinem trivialen Leben existiert und Widerstand leistet. Durch die Erwähnung, dass dieser Mann auch ein Dichter ist, eröffnet Drummond die Möglichkeit, José mit dem Autor selbst zu identifizieren.
Es stellt auch eine damals sehr verbreitete Frage: Was nützt die Poesie oder das geschriebene Wort in einer Zeit des Krieges, des Elends und der Zerstörung?
Zweite Strophe
Er ist ohne Frau,
ist ohne Sprache,
ist ohne Zuneigung,
nicht mehr trinken kann,
darf nicht mehr rauchen,
Spucken ist nicht mehr erlaubt,
wurde die Nacht kalt,
der Tag ist nicht gekommen,
Die Straßenbahn ist nicht gekommen,
Das Lachen blieb aus,
die Utopie ist nicht gekommen
und es ist alles vorbei
und alles lief davon
und alles ist verschimmelt,
Und jetzt, José?
Hier wird der Gedanke der Leere, der Abwesenheit und der Bedürftigkeit verstärkt: Er ist ohne "Frau", "Sprache" und "Zuneigung"; er erwähnt auch, dass er nicht mehr "trinken", "rauchen" und "spucken" kann, als ob seine Triebe und Verhaltensweisen überwacht würden, als ob er nicht frei wäre, das zu tun, worauf er Lust hat.
Er wiederholt, dass "die Nacht kalt geworden ist" und fügt hinzu, dass "der Tag nicht gekommen ist", so wie "die Straßenbahn", "das Lachen" und "die Utopie" nicht gekommen sind. Alle möglichen Auswege, alle Möglichkeiten, die Verzweiflung und die Realität zu umgehen, sind nicht gekommen, nicht einmal der Traum, nicht einmal die Hoffnung auf einen Neuanfang. Alles ist "zu Ende", "geflohen", "vermodert", als hätte die Zeit alles Gute verdorben.
Dritte Strophe
Was nun, José?
Sein süßes Wort,
seinen Fieberanfall,
ihre Völlerei und ihr Fasten,
Ihre Bibliothek,
seine Goldmine,
seinen gläsernen Anzug,
seine Inkohärenz,
Ihr Hass - was nun?
Er listet auf, was immateriell ist, was dem Subjekt eigen ist ("sein süßes Wort", "sein Fiebermoment", "seine Völlerei und sein Fasten", "seine Inkohärenz", "sein Hass") und im direkten Gegensatz dazu, was materiell und greifbar ist ("seine Bibliothek", "seine Goldmine", "sein Glasanzug"). Nichts blieb, nichts blieb, nur die unermüdliche Frage blieb: "Und nun, José?
Vierte Strophe
Mit dem Schlüssel in der Hand
will die Tür öffnen,
es gibt keine Tür;
will auf See sterben,
aber das Meer trocknete aus;
will nach Minas gehen,
Es gibt keine Minen mehr.
José, was nun?
Das lyrische Subjekt weiß nicht, wie es sich verhalten soll, es findet keine Lösung angesichts der Lebensverdrossenheit, wie in den Versen "Mit dem Schlüssel in der Hand / will er die Tür öffnen, / es gibt keine Tür" sichtbar wird. José hat keinen Sinn und keinen Platz in der Welt.
Es gibt nicht einmal die Möglichkeit des Todes als letzten Ausweg - "er will auf dem Meer sterben, / aber das Meer ist ausgetrocknet" - eine Idee, die im weiteren Verlauf noch verstärkt wird. José ist gezwungen zu leben.
Mit den Versen "quer ir para Minas, / Minas não existe mais" schafft der Autor einen weiteren Hinweis auf die mögliche Identifikation zwischen José und Drummond, denn Minas ist seine Heimatstadt. Es ist nicht mehr möglich, an den Ort der Herkunft zurückzukehren, das Minas seiner Kindheit ist nicht mehr dasselbe, es existiert nicht mehr. Auch die Vergangenheit ist keine Zuflucht.
Fünfte Strophe
Wenn du rufst,
wenn du stöhnst,
wenn Sie gespielt haben
den Wiener Walzer,
wenn du geschlafen hast,
wenn Sie müde werden,
wenn du sterben würdest
Aber man stirbt nicht,
Du bist hart im Nehmen, José!
In der Passage werden durch den Konjunktiv Imperfekt mögliche Flucht- oder Ablenkungsmanöver ("schreien", "stöhnen", "sterben") angedeutet, die aber nicht zustande kommen. Diese Handlungen werden unterbrochen, sie werden in der Schwebe gehalten, was durch die Verwendung von Zurückhaltung gekennzeichnet ist.
Dass auch der Tod keine plausible Lösung ist, wird einmal mehr in den Versen "Aber du stirbst nicht / Du bist zäh, José!" deutlich: Die Anerkennung der eigenen Stärke, Widerstandsfähigkeit und Überlebensfähigkeit scheint zum Wesen dieses Subjekts zu gehören, für das das Leben aufzugeben keine Option sein kann.
Sechste Strophe
Allein in der Dunkelheit
Was für ein Murmeltier,
ohne Theogonie,
keine kahle Wand
zum Anlehnen,
kein schwarzes Pferd
der im Galopp davonläuft,
Du marschierst, José!
José, wohin?
In der Strophe "Allein im Dunkeln / Wie ein Tier im Busch" wird seine totale Isolation deutlich. In " sem teogonia" geht es um die Vorstellung, dass es keinen Gott, keinen Glauben und keine göttliche Hilfe gibt. "Keine kahle Wand / zum Anlehnen": ohne Unterstützung durch irgendetwas oder irgendjemanden; "kein schwarzes Pferd / das davon galoppiert" bringt das Fehlen einer Möglichkeit, der Situation, in der er sich befindet, zu entkommen.
Das Gedicht endet mit einer neuen Frage: "José, wohin?" Der Autor macht deutlich, dass dieser Mensch vorwärts geht, auch wenn er nicht weiß, mit welchem Ziel oder in welche Richtung, da er sich nur auf sich selbst, auf seinen eigenen Körper verlassen kann.
Siehe auch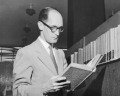 Die 32 besten Gedichte von Carlos Drummond de Andrade analysiert
Die 32 besten Gedichte von Carlos Drummond de Andrade analysiert  Gedicht Quadrilha, von Carlos Drummond de Andrade (Analyse und Interpretation)
Gedicht Quadrilha, von Carlos Drummond de Andrade (Analyse und Interpretation) 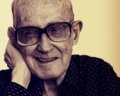 Gedicht Middle of the Road von Carlos Drummond de Andrade (Analyse und Bedeutung)
Gedicht Middle of the Road von Carlos Drummond de Andrade (Analyse und Bedeutung) Das Verb "marschieren", eines der letzten Bilder, die Drummond in dem Gedicht druckt, scheint in der Komposition selbst sehr bedeutsam zu sein, durch die sich wiederholende, fast automatische Bewegung. José ist ein Mann, der in seiner Routine feststeckt, in seinen Verpflichtungen, ertrunken in existenziellen Fragen, die ihn quälen. Er ist Teil der Maschine, des Getriebes des Systems, er muss seine täglichen Handlungen fortsetzen, wie ein Soldat in seinemtägliche Kämpfe.
Dennoch lassen die letzten Verse angesichts einer pessimistischen Weltanschauung eine Spur von Hoffnung oder Stärke erkennen: José weiß nicht, wohin er geht, was sein Schicksal oder sein Platz in der Welt ist, aber er "marschiert weiter", überlebt, widersteht.
Lesen Sie auch die Analyse des Gedichts No Meio do Caminho von Carlos Drummond de Andrade.
Historischer Kontext: Zweiter Weltkrieg und Estado Novo
Um das Gedicht in seiner Gesamtheit zu verstehen, muss man sich den historischen Kontext vergegenwärtigen, in dem Drummond lebte und schrieb. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, befand sich Brasilien ebenfalls in einem diktatorischen Regime, dem Estado Novo von Getúlio Vargas.
Es herrschte ein Klima der Angst, der politischen Unterdrückung und der Ungewissheit über die Zukunft. Der Zeitgeist scheint durch, verleiht dem Gedicht politische Anliegen und drückt die alltäglichen Sorgen des brasilianischen Volkes aus. Auch die prekären Arbeitsbedingungen, die Modernisierung der Industrie und die Notwendigkeit, in die Metropolen auszuwandern, machten das Leben des einfachen Brasilianers zu einem ständigen Kampf.
Carlos Drummond de Andrade und der brasilianische Modernismus
Der brasilianische Modernismus, der während der Woche der Modernen Kunst von 1922 entstand, war eine kulturelle Bewegung, die darauf abzielte, mit den klassischen und eurozentrischen Normen und Modellen zu brechen, die ein Erbe des Kolonialismus waren.
In der Poesie wollte er die konventionellen poetischen Formen, die Verwendung von Reimen, das metrische System der Verse oder die bis dahin als lyrisch geltenden Themen abschaffen und strebte nach größerer kreativer Freiheit.
Der Vorschlag lautete, auf Formalismus und Eitelkeiten sowie auf die poetischen Kunstgriffe der Zeit zu verzichten und dafür eine alltäglichere Sprache zu verwenden, die Themen der brasilianischen Realität aufgreift, um so die Kultur und die nationale Identität aufzuwerten.
Carlos Drummond de Andrade wurde am 31. Oktober 1902 in Itabira, Minas Gerais, geboren und gilt als einer der größten brasilianischen Dichter des 20. Jahrhunderts.
Er gehörte zur zweiten modernistischen Generation (1930-1945), die die Einflüsse der vorangegangenen Dichter aufnahm und sich mit den soziopolitischen Problemen des Landes und der Welt auseinandersetzte: Ungleichheiten, Kriege, Diktaturen, das Auftauchen der Atombombe.
Die Poetik des Autors offenbart auch eine starke existenzielle Fragestellung, das Nachdenken über den Sinn des menschlichen Lebens und den Platz des Menschen in der Welt, wie wir in dem zu analysierenden Gedicht sehen können.
Im Jahr 1942, als das Gedicht veröffentlicht wurde, lebte Drummond den Zeitgeist, indem er politische Lyrik schrieb, die die alltäglichen Schwierigkeiten der einfachen Brasilianer zum Ausdruck brachte, ihre Zweifel und Ängste sowie die Einsamkeit der Menschen aus dem Landesinneren, die sich in der großen Stadt verloren hatten.
Drummond starb am 17. August 1987 in Rio de Janeiro an den Folgen eines Herzinfarkts und hinterließ einen umfangreichen literarischen Nachlass.


